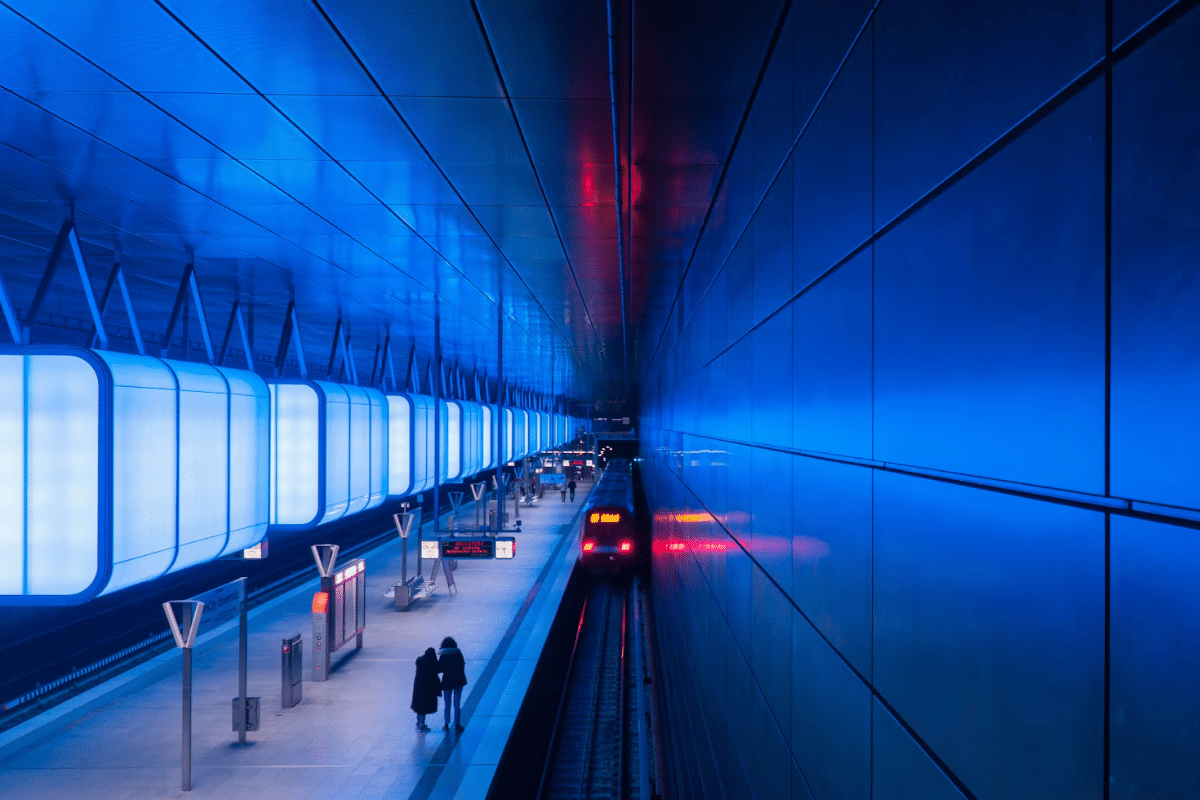Ein erfolgreicher Exit zählt für jeden Unternehmenden mit Sicherheit zu einem der Höhepunkte seiner Karriere. Zahlreiche Unternehmen werden von Anfang an nur darauf ausgerichtet. Für die GründerInnen bedeutet er oft die finanzielle Freiheit.
In den seltensten Fällen endet die Geschichte jedoch mit dem Verkauf. Die operativen GesellschafterInnen bleiben meist noch zwischen 1 bis 4 Jahre dabei, um die Firma zu übergeben bzw. um die gemeinsamen Pläne mit dem/ der neuen EigentümerIn zu realisieren. Der sogenannte Earnout ist bei vielen Deals größer als der initiale Kaufpreis. Es lohnt sich also nicht sofort auf die Insel zu fliegen und Cocktails zu schlürfen.
Damit stellt sich unweigerlich die Frage: Was verändert sich für den/ die GründerIn/CEO in der alltäglichen Arbeit, wenn er/sie nun für einen großen Konzern arbeitet?
Als Unternehmer habe ich das zweimal erleben dürfen: sowohl Absolventa als auch Passion 4 Gästezimmer (monteurzimmer.de & pension.de) haben wir an einen deutschen Konzern verkauft. Befreundeten Unternehmern habe ich darüber hinaus geholfen ihre Firmen ebenfalls an Konzerne zu verkaufen, wie z.B. die Deutsche Auftragsagentur (DAA) an Bosch. Unzählige Gespräche mit anderen UnternehmerInnen zu diesem Thema runden mein Bild ab. Einige Themen, die sich immer wieder wiederholen, will ich an dieser Stelle teilen.
#1 Finanzplanung und richtige Kennzahlen
Je nachdem, wie etabliert das Unternehmen zum Zeitpunkt des Exits ist, ist die Finanzplanung und das Reporting mehr oder weniger ausgereift. In fast allen mir bekannten Fällen ist der präzisen Planung und dem monatlichen Reporting nach dem Exit eine viel größere Bedeutung zugekommen als zuvor.
Im Start-up geht es oft nur darum zu wachsen und dabei nicht pleitezugehen. Wie das im Detail funktioniert, wird im laufenden Betrieb irgendwie herausgefunden. Keiner erwartet, dass GründerInnen in frühen Phasen jede Maßnahme im Detail durchplanen und alle Entwicklungen voraussehen. Firma wächst – alles super. Firma wächst nicht – großes Problem.
Im Konzern hingegen dreht sich alles um die akkurate Planung. Auch schlechte Entwicklungen sind nur halb so schlimm, solange sie im Budget rechtzeitig antizipiert worden sind.
An die Bedeutung bestimmter Kennzahlen muss man sich erst gewöhnen. So dreht sich oftmals alles z.B. um das EBITDA, das mitnichten damit gleichzusetzen ist, dass am Monatsende noch genügend Geld auf dem Konto ist. Hohe Ausgaben sind unproblematisch, solange sie aktiviert werden können und diese „Investitionen“ schön sauber geplant sind.
#2 Du bist jetzt Angestellte/r
Im Rahmen des Verkaufsprozesses werden Käufer nicht müde zu betonen, dass sie deine Firma auch kaufen, um echte UnternehmerInnen mit all ihren Ecken und Kanten in den Konzern zu integrieren. Das für den Kauf verantwortliche Management meint das in der Regel ernst.
Klar ist aber auch, dass in jedem Konzern eine ganze Armee von ControllerInnen und VerwalterInnen kein Interesse daran hat, dass UnternehmerInnen ihre Organisation durcheinanderwirbeln. So ist es aus meiner Erfahrung nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, Unternehmensanteile z.B. an einer mit dem Konzern zusammen neu gegründeten Tochtergesellschaft zu bekommen. Gehälter müssen sich innerhalb des Konzerns in entsprechenden Gehaltsbändern bewegen. Neue Projekte werden nicht mehr nur daraufhin überprüft, ob sie Wachstum oder Profit bringen. Politik spielt eine große Rolle.
Am Ende prallen zwei Welten aufeinander: Der Unternehmer/ die Unternehmerin hält maximale Freiheit für selbstverständlich, der Konzern erwartet eine/n loyale/n Angestellte/n, der/die sich an die Regeln hält. Der Satz „Das hättest du doch davor abstimmen müssen!“ ist ein ständiger Begleiter.
#3 Konzernintegration sucks
In einem Start-up müssen Dinge funktionieren, in einem Konzern vor allem den Konzernstandards entsprechen. Klassiker sind dabei das Rechnungswesen, die Einkaufsprozesse oder die Lohnbuchhaltung.
Vor dem Verkauf haben wir Buchhaltung und Lohnabrechnung mit einem mittelständischen Berliner Steuerbüro gemacht. Wir haben uns darum gekümmert, dass die Belege vollständig sind, das Steuerbüro hat alles in Datev gebucht, fertig. Das ist kein Hexenwerk und hat gut funktioniert. Nach einer gewissen „Schonfrist“ mussten wir im Konzern aber auf SAP umstellen. Oder das Thema Einkaufsprozesse: Zuvor haben wir Toilettenpapier pragmatisch bei Amazon bestellt, im Konzern muss das über den Zentraleinkauf laufen. Die erwarteten Kosteneinsparungen durch die Bündelung der Aufträge vieler Konzerngesellschaften klingen in der Theorie gut. In unserem Fall haben wir vorher vieles günstiger über Amazon beschafft als später über den sperrigen Prozess des Zentraleinkaufs.
In einem Satz: Die beschriebenen Themen sind in erster Linie nervig und kosten eine Menge Zeit. Ich empfehle direkt nach dem Verkauf eine Stelle zu schaffen, die sich nur um die Koordination dieser Integrationsthemen kümmert. Die Kosten dafür bereinigt der Konzern meiner Erfahrung nach gerne aus der Kostenbasis heraus – der Earnout wird dadurch entsprechend nicht belastet.
#4 Wer kauft dein Unternehmen?
Nicht der Konzern treibt eine Akquisition. Es sind immer ManagerInnen, die mit der Akquisition ein bestimmtes Problem lösen wollen. Dieses Problem genau zu verstehen ist entscheidend: Soll EBITDA zugekauft werden? Geht es um Marktanteile? Ist die Akquisition das Ergebnis einer Buy-or-Build-Entscheidung? Ist der Zukauf Teil einer größeren Börsen-Story?
Nicht selten geht es auch um individuelle Ziele des Konzernmanagers. Meine Empfehlung ist, sich direkt am Anfang mit dem Management zusammenzusetzen um ihre Motivationslage zu verstehen: „Was ist denn für dich wichtig? Woran wirst du gemessen?“. Solange noch kein Vertrauensverhältnis besteht, ist die Antwort vielleicht: „Also für mich ist es wichtig, dass wir als Konzern erfolgreich sind“. Das ist sicherlich richtig. Dennoch verknüpft das Management auch eine persönliche Motivation mit der Akquisition deines Unternehmens und man sollte nicht müde werden diese genau zu verstehen.
#5 Es gibt sehr viel zu lernen
Die Arbeit als Konzernangestellter ist nicht immer nur erfüllend. Gleichzeitig kann ich UnternehmerInnen nicht verstehen, die alles schlechtreden und sich ununterbrochen über die Ineffizienzen innerhalb eines Konzerns lustig machen. Bei genauerem Hinsehen machen viele Prozesse durchaus Sinn. Bei einem Geschäft mit vielen Milliarden Euro Umsatz und Tausenden von Arbeitsplätzen ist eine allzu pragmatische Arbeitsweise unter Risikogesichtspunkten oftmals nur schwer zu rechtfertigen. Gerade Transformationsprozesse brauchen Zeit und viele Interessengruppen müssen abgeholt werden.
Ich habe meine insgesamt knapp 4 Jahre im Konzern als eine Art MBA Programm betrachtet. Schließlich funktioniert so ein großer Teil unserer Wirtschaft und ich hatte von dieser Welt keine Ahnung. Insbesondere als Unternehmer, der vielleicht auch künftig wieder Firmen an Konzerne verkaufen möchte, ist es äußerst wertvoll, seinen Kunden genau zu kennen.
Fazit
Auf meine Zeit im Konzern nach den Exits schaue ich alles in allem sehr positiv zurück. Vielleicht kommt das für den oder die einen oder anderen jetzt ein wenig überraschend. Ja, vieles ist nervig und dem Unternehmer in mir hat es oft alle Nackenhaare aufgestellt. Gleichzeitig habe ich aber viel gelernt und verstehe jetzt das Innenleben eines Konzerns deutlich besser bzw. habe mehr Verständnis für die handelnden Personen. Wirtschaftlich war die Zusammenarbeit mit unseren KäuferInnen für alle Beteiligten sehr fruchtbar: Beide Male haben wir die gesteckten Earnout-Ziele noch übertroffen.
Eine Partnerschaft auf Zeit mit einem Konzern kann sehr wertvoll sein – für waschechte UnternehmerInnen ist sie aber in den seltensten Fällen eine Dauerlösung.